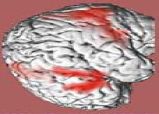Nachdem das Volk entsprechende Vorstösse zweimal, am 7. Februar 1999 die Initiative „Wohneigentum für alle“ und am 16. Mai 2004 im Rahmen der Vorlage zur Reform der Ehe- und Familienbesteuerung sowie der Wohneigentumsbesteuerung, deutlich abgelehnt hat, versucht der Hauseigentümerverband ein drittes Mal über die Initiative „Sicheres Wohnen im Alter“ für seine Mitglieder zusätzliche Subventionen zu erhalten.
Die derzeitige Regelung ist ökonomisch sinnvoll und fair. Das (selbstgenutzte) Wohnhaus ist – ökonomisch betrachtet – eine unter vielen Anlageformen für die privaten Ersparnisse, wie z.B. Sparguthaben, Aktien oder Obligationen. Die heutige Regelung macht dazwischen keinen Unterschied: Sie behandelt denjenigen, der sein Geld in seinem Haus investiert und sich damit die Miete spart, genauso wie jenen, der sein Geld auf dem Kapitalmarkt anlegt, dafür Zinsen erhält und zur Miete wohnt. Damit werden unterschiedliche Anlageformen gleich behandelt. So wie derjenige, der Zinsen erhält, davon Steuern zahlen muss, muss der Eigenheimbesitzer die Miete, die er implizit an sich selbst zahlt, versteuern. Dafür darf er Renovationsarbeiten genauso wie Schuldzinsen vom steuerbaren Einkommen absetzen. Tatsächlich wird der Eigenheimbesitzer heute sogar subventioniert, soweit bei der Steuer nicht der volle Verkehrswert angesetzt wird.
Das Eigenheim wird hier als Investitionsobjekt betrachtet. Man kann es auch als Konsumgut ansehen, wie z.B. ein Auto. Dann macht die Besteuerung des Eigenmietwerts keinen Sinn, aber es gibt auch keinen Grund, Renovationskosten vom steuerbaren Einkommen abzusetzen. Schliesslich kann ich dies bei meiner Autoreparatur auch nicht. Zudem gibt es dann keine Rechtfertigung dafür, Schuldzinsen steuerlich zu berücksichtigen. Dies gilt auch, wenn man den Schuldzinsenabzug in der Höhe begrenzen will.
Beim Systemwechsel ergibt sich freilich ein Problem mit den Mietwohnungen von Privateigentümern. Sollen hier die Mieteinnahmen weiterhin steuerpflichtig sein (wie Zinsen und Dividenden bei anderen Anlageformen), wofür sicher einiges spricht, sollten hier Schuldzinsen und Renovationskosten konsequenterweise weiterhin abzugsfähig sein. Steuersystematisch ist es zwar nicht elegant, bei privaten Eigentümern eigengenutztes Wohneigentum als Konsumgut und fremdgenutztes als Investitionsgut zu betrachten. Dennoch aber wäre es beim Systemwechsel erforderlich, um nicht neue Ungerechtigkeiten aufkommen zu lassen.
Man mag sich darüber streiten, welche der beiden Regelungen sinnvoller ist: die heutige oder eine Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung. Im Prinzip ist es sinnvoller, Ausgaben für ein Wohnhaus als Investition zu betrachten; deshalb besteht eigentlich kein Änderungsbedarf. Andererseits ist nicht zu bestreiten, dass beide Regelungen Vor- und Nachteile haben und dass man deshalb für beide eintreten kann. Die Initiative des Hauseigentümerverbands möchte jedoch den Fünfer und das Weggli: Beim möglichen Wechsel zum System ohne Eigenmietwertbesteuerung, der freilich erst nach Erreichen des AHV-Alters möglich sein soll, sollen Unterhaltskosten bis zum Betrag von 4000 Franken nach wie vor abzugsfähig sein. Hier wird für eine spezielle Gruppe eine Subvention gefordert, die sich kaum rechtfertigen lässt. Es ist, wie wenn man fordern würde, dass beim privat genutzten PKW, der ja auch ein ‚Investitionsobjekt‘ ist, die Kosten für den Service steuerlich geltend gemacht werden können.
Es ist zu hoffen, dass das Volk auch diesem Vorstoss wieder eine Abfuhr erteilen wird.
(Eine ausführliche Diskussion der Eigenmietwertbesteuerung findet sich in: G. Kirchgässner, Eine moderne Steuer- und Abgabenordnung für die Schweiz: Vorüberlegungen und Grundzüge, Rüegger, Chur/Zürich 1999, S. 73ff.)