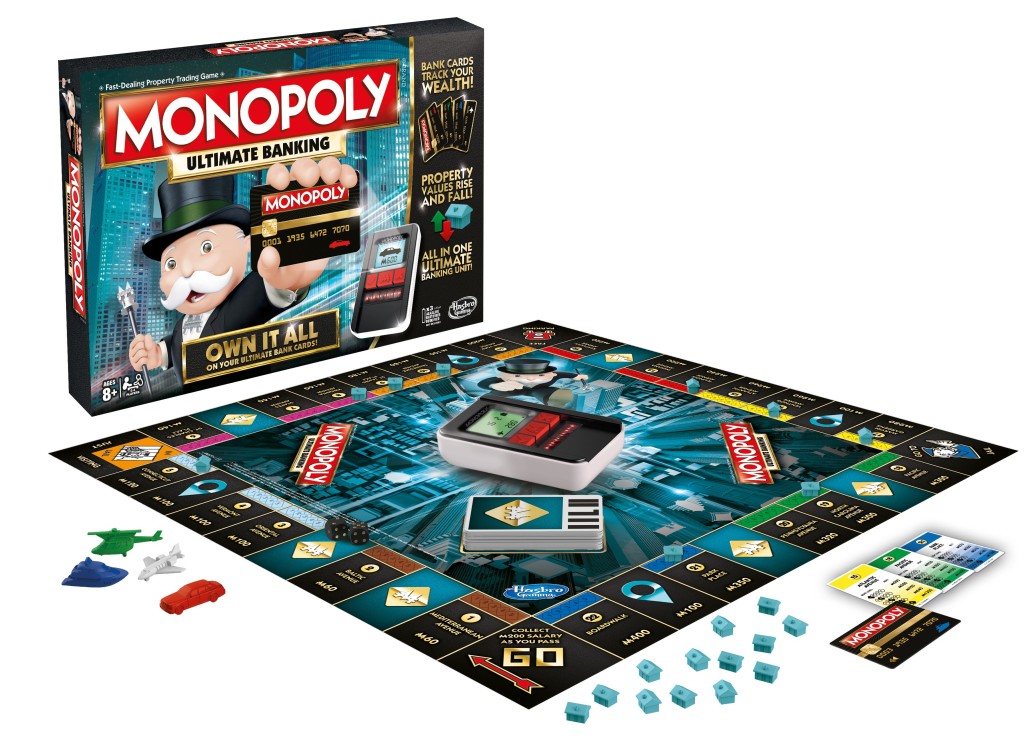Monika Bütler
Der Beitrag erschien am 15. Mai 2016 in der NZZ am Sonntag.
Eine kleine Ergänzung: Die schweizerische Maturaquote von rund 20% verdeckt, dass nur 16.5% der jungen Männer bei uns eine Matura machen. Das ist teilweise auf die attraktiven Möglichkeiten ausserhalb des akademischen Bildungswegs zurückzuführen. Aber nicht nur – viele intelligente Kinder, die eigentlich eine Matura machen wollten, geben entnervt auf. Das sollte uns zu denken geben. In einigen Kantonen ist die Maturaquote bei den jungen Männern in den letzten zwei Jahrzehnten sogar gesunken. So zum Beispiel im Kanton Zürich von 18% im Jahre 1998 auf nur noch 15.2 in 2012. (Quelle: avenir suisse)
Hier also die Kolumne:
Die schweizerische Matura sei zu einfach. Sogar Hochschulrektoren melden diplomatisch Zweifel an der Fitness ihrer Frischlinge an. Neben motivierten, gescheiten und aufmüpfigen Studierenden sitzen viele in den Bänken, bei denen nicht klar ist, weshalb sie – auf Kosten der Steuerzahler – dasitzen. Und: wie sie die Matura geschafft haben.
Nur: Wenn wir es bei einer Maturaquote von nur 20% nicht fertig bringen, junge Menschen studierfähig auszubilden, läuft etwas Grundlegendes falsch. Entweder bilden wir falsch aus. Oder wir selektieren falsch.
Lücken im Wissen können geschlossen werden, wenn Motivation und Intelligenz stimmen. Doch da hapert es oft genauso wie bei den Fähigkeiten in Deutsch oder Mathematik. Es ist ärgerlich, überforderte Studenten vor sich zu haben. Deprimierender ist aber der Gedanke, dass bei der tiefen Schweizer Maturaquote, für jeden von diesen ein anderer, motivierter und fähigerer Kandidat existiert, der die Hürde aus irgendeinem Grund nicht geschafft hat.
Nur schon die krasse Untervertretung der Knaben und Ausländer lassen vermuten, dass wir nicht immer diejenigen selektieren, die für den akademischen Bildungsweg geeignet sind. Dabei ist die oft geschmähte Selektion in die Mittelschule nicht einmal die einzige Hürde auf dem Weg zur Matura.
Wer einmal im Gymi ist, kämpft mindestens vier Jahre lang mit den Tücken des Systems. Das Paradebeispiel der Exzellenzverhinderung ist dabei die Anforderung der doppelten Kompensation ungenügender Noten. Konkret: Eine 5.5 in Mathematik und eine 5.0 in Deutsch (zusammen 2.5 Pluspunkte) reichen nicht, um eine 2.5 in Geographie (= 3 Minuspunkte) zu kompensieren.
In typisch schweizerischer Manier – wer aus der Masse ragt, wird geköpft –verstärken wir ein ohnehin schon absurd zu ungenügenden Noten hin verzerrtes Bewertungssystem noch, verdoppeln doppelt ungenügend sozusagen. Viele gescheite Knaben und – etwas weniger oft – Mädchen geben deswegen frustriert auf oder werden ausgemustert. Andere schaffen es, indem sie, statt ihre Stärken ausleben zu können, ihre Energie im Kampf gegen ihre Schwächen verlieren – an die sie dadurch auch regelmässig erinnert werden.
Besonders hart trifft die doppelte Kompensation mathematisch begabte Kinder an den meist sprachlastigen Gymnasien. Aber nicht nur sie. Auch Kolleginnen aus den philosophischen Fakultäten klagen: Weshalb soll ein Schüler mit 4.0 in allen Fächern Geisteswissenschaften studieren können, nicht aber jemand mit 5.5 in Deutsch und 3.0 in Naturwissenschaften?
Mittelschullehrer machen geltend, dies sei in der Praxis nicht so schlimm, die Schülerinnen passten sich einfach an. Nur: wir zwingen – gegen alle wissenschaftliche Evidenz des Lernens – die Schülerinnen dennoch, ihre Schwächen zu schwächen, statt ihre Stärken zu stärken.
Statt von Begabungsspitzen zu sprechen, reden wir eher – leicht abschätzig – von einseitiger Begabung. Eine solche ist offenbar so schlimm ist, dass sie bestraft werden muss. Dabei stammen die meisten technologischen Durchbrüche, aber auch viele Ideen in anderen Wissenschaften nicht aus einer Durchschnittskompetenz, sondern aus einer besonderen – daher oft einseitigen – Begabung.
Ob die Matura zu einfach sei, ist nicht die relevante Frage. Wichtiger wäre es dafür zu sorgen, dass den intelligentesten Kindern nicht die Schule vermiest und der Weg zu einer Universitätsausbildung erschwert wird. Diese Talente werden uns nämlich fehlen: Viele Hochqualifizierte, die wir selber hätten ausbilden können, importieren wir heute aus dem Ausland.