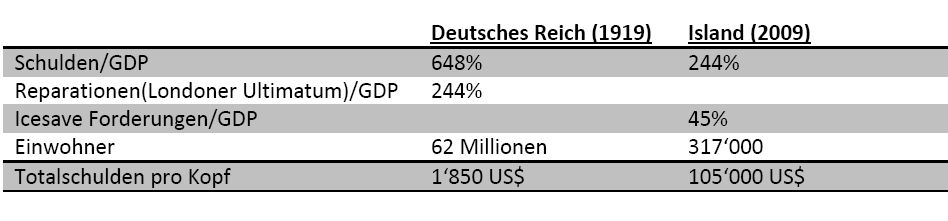Ein Meinungsartikel in der Süddeutschen Zeitung hat es kürzlich auf den Punkt gebracht: Staaten sind jetzt die Sorgenkinder der Finanzmärkte. Der Verlauf der Finanzkrise mit ihrem jüngsten Höhepunkt, der Schuldenkrise in der EU, macht deutlich, dass die Kreditaufnahme entscheidend vom Vertrauen der Anleger (und der Gunst der Spekulanten) abhängt. Schwindet das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit — sprich die Erwartung, dass die Schulden auch zurückgezahlt werden können — trocknen die Finanzierungsquellen schnell aus und es werden saftige Risikoaufschläge fällig. Bisher dachte man eben, Staaten werden immer ihre Schulden begleichen. Doch plötzlich scheint dieses Grundvertrauen erschüttert, weil nicht mehr klar ist, ob und wie Länder wie Griechenland ihr Defizit reduzieren und ihren Schuldenberg mittelfristig abbauen sollen. Außerdem erscheint in Zeiten historisch niedriger Zinsen auch die Angst vor Staatsbankrotten ein willkommenes Phänomen zu sein, um Zinsforderungen (Risikoprämien) zu erhöhen. Dabei sind die Probleme nicht neu; einige Länder — wie z.B. Griechenland — schieben schon geraume Zeit vergleichsweise hohe Schuldenberge vor sich her.
Ein anderer Aspekt der Schuldenproblematik ist dagegen bisher in der Öffentlichkeit kaum thematisiert worden: die sich bereits seit längerem abzeichnenden demographischen Verwerfungen. Schliesslich spielt das Entwicklungs- und Produktionspotential einer Volkswirtschaft eine entscheidende Rolle dafür, wieviele Schulden sich ein Land leisten kann. Das Produktionspotential hängt wiederum unmittelbar von der demographischen Entwicklung ab; vor allem davon, wie groß die Erwerbsbevölkerung relativ zur Gesamtbevölkerung ist und wie produktiv diese Erwerbsbevölkerung ist. Alterung und die Pensionierung geburtenstarker Jahrgänge werden hier spürbare Veränderungen auslösen, die nicht unbedingt „defizitfreundlich“ sein dürften. Im Gegenteil: die Belastung der Sozialkassen wird bei gleichzeitig schrumpfender Erwerbsbevölkerung zunehmen. Die aktuelle Vertrauenskrise auf den Finanzmärkten macht dieses Szenario umso bedrohlicher, denn überschuldete Staaten, deren Defizite durch die Krise ansteigen, haben in Zukunft auch mit größeren strukturellen Belastungen zu rechnen.
Ein BIS discussion paper von Cecchetti, Mohanty und Zampolli bringt diese Problematik auf den Punkt: Nimmt man die gegenwärtigen krisenbedingten Defizite und schreibt die demographiebedingten strukturellen Defizite in die Zukunft fort, so kommt man schnell auf Schuldenszenarien, in denen die meisten Länder plötzlich sehr schlecht positioniert sind (interessanterweise besonders die USA und Großbritannien, weniger aber Italien — was wiederum die Frage nach den zugrundeliegenden Annahmen aufwirft). Wie präzise diese Abschätzung im Detail auch sein mag, der Hauptpunkt ist richtig: Die Strukturprobleme werden sich in den Staatsfinanzen niederschlagen und die Krise verschärft diese Problematik noch weiter. Freilich wirft die Studie implizit die Frage auf, ab wann strukturelle Defizite als nicht mehr tragbar angesehen werden müssen und wann der Schuldenberg einfach zu hoch ist, um je abgetragen werden zu können. Die Anleger werden diese Frage mit entsprechend höheren Risikoprämien beantworten mit dem für sie angenehmen Nebeneffekt höherer Kapitalerträge.