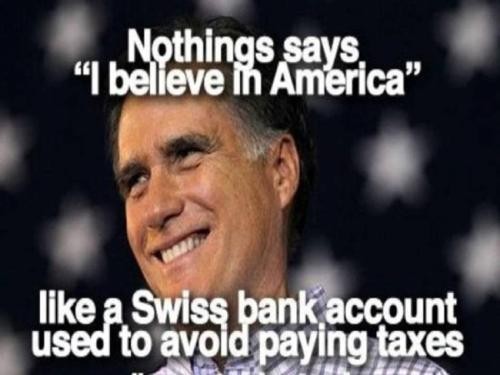Monika Bütler
Mit etwas Verspätung hier meine letzte NZZ am Sonntag Kolumne, publiziert am 14. Juli 2013 unter dem Titel: „Die Privatsache der andern geht uns nichts an: Es geht uns allen am besten, wenn wir uns nicht gegenseitig unsere Freiheit beschneiden.“
Unser Jüngster, durchaus kommunikativ und umgänglich, wird einsilbig wenn er uns etwas über die Schule erzählen soll: „Das gaat oi nüüt aa!“, heisst es dann. Lange vor Edward Snowdens Enthüllungen verbat er sich jede Form von Überwachung. Wer seinen Schulthek auch nur von weitem ansieht, kriegt Ärger. Erzählt er sporadisch doch etwas, dann eher über eine zweckentfremdete Schere im Werken (zum gegenseitig Haare schneiden) als über den Mathetest.
Solange Reklamationen der Schule ausbleiben und seine Noten ungefähr seinem Potential entsprechen, lassen wir unseren Junior in Ruhe. Leistungsauftrag heisst das heute. Dass er dieselbe Informationspolitik – geht Euch nichts an – auch in seinen Aufsätzen zum Thema „Mein Wochenende“ verfolgt, geht uns dann nichts mehr an.
Des Buben Sinn für Nichteinmischung mag etwas ausgeprägt sein, er ist uns aber allen angeboren. Jugendliche wehren sich für mehr Freiräume, gegen die Bevormundung der Eltern, die Einmischung und Überwachung durch Schule und Staat. Sogar die Ökonomen – sonst über vieles uneinig – sind für einmal einer Meinung: Es geht uns allen am besten, wenn der Staat sich nur dann einmischt, wenn dritte – Kinder, die Umwelt, die Steuerzahler – sonst wehrlos zu Schaden kommen. Vorschriften, die in private Abmachungen eingreifen sind im besten Fall unnütz, meistens schädlich und immer teuer.
Schade nur, dass uns dieser Freiheitssinn so schnell abhanden kommt wenn es um andere geht. Die Freiheit der andern ist zwar OK, nur nicht grad im konkreten Fall – bei der Höhe der Fenstersims, in der Buchhaltung der Firma, bei der Zulassung des Kinderbetreuers. Über Politiker und Bürokraten zu schimpfen, greift allerdings zu kurz. Die Vorschläge zur Beschränkung der Löhne, zum Beispiel die 1:12-Initiative, stammen aus der Basis. Genau genommen aus Kreisen, die Freiraum für sich selber lautstark fordern. „Binz bleibt!“ hiess es bis vor kurzem in unserer Nachbarschaft. Den Unternehmen wird ihre legale Binz jedoch aberkannt obwohl wir alle davon profitieren. So ärgerlich sie sind, überrissene Löhne sind Privatsache, solange sie nicht über Steuern teilweise mitfinanziert werden. Beispielsweise in Firmen und Branchen, die direkt oder indirekt vom Staat unterstützt werden. Man wünschte sich, die Jusos würden mit derselben Verve für eine bessere (Finanzmarkt-)Regulierung kämpfen. Eine, die wirklich verhindert, dass sich eine Minderheit auf Kosten der Allgemeinheit Vorteile verschafft.
Die Freiheit der andern ist immer ein Problem. So verschwindet scheibchenweise die Freiheit aller. Widerstand gegen Eingriffe in private Entscheidungen regt sich nicht einmal mehr, wenn eine vorgeschlagene Massnahme direkt fast jeden trifft und niemandem wirklich nützt. So ist die von Bundesrat Berset vorgeschlagene Erhöhung des Mindestrentenalters im BVG von 58 auf 62 Jahre eine starke Einmischung in eine im Grunde rein private Abmachung zwischen Firma/Pensionskasse und den Angestellten. Verliert eine 59-jährige ihre Arbeit, wird sie nur schwer eine neue Stelle finden. Statt der Person einen grösstenteils selbstfinanzierten Rücktritt in Würde zu ermöglichen, generiert die Vorschrift eine individuelle Tragödie, verbunden mit sehr viel höheren Kosten für die Allgemeinheit. Ohne die Möglichkeit zur Frühpensionierung bleiben der Entlassenen nur die IV (wenn sie Glück hat) oder – unter Verlust eines Teils der Versicherungsleistung – ALV und später Sozialhilfe.
Viele Eingriffe in private Entscheidungen mögen für sich alleine genommen klein sein. Zusammen sind sie nicht mehr harmlos. Und mit jeder neuen Einschränkung wächst gerade bei Firmen die Angst, dass in der Zukunft noch mehr kommt. Umso erstaunlicher, wie leichtfertig wir anderen und letztlich gemeinsam uns selber den Ast der Freiheit absägen. Hätten wir doch öfter den Mut wie unser Bengel zu sagen: Das gaat oi nüüt aa!