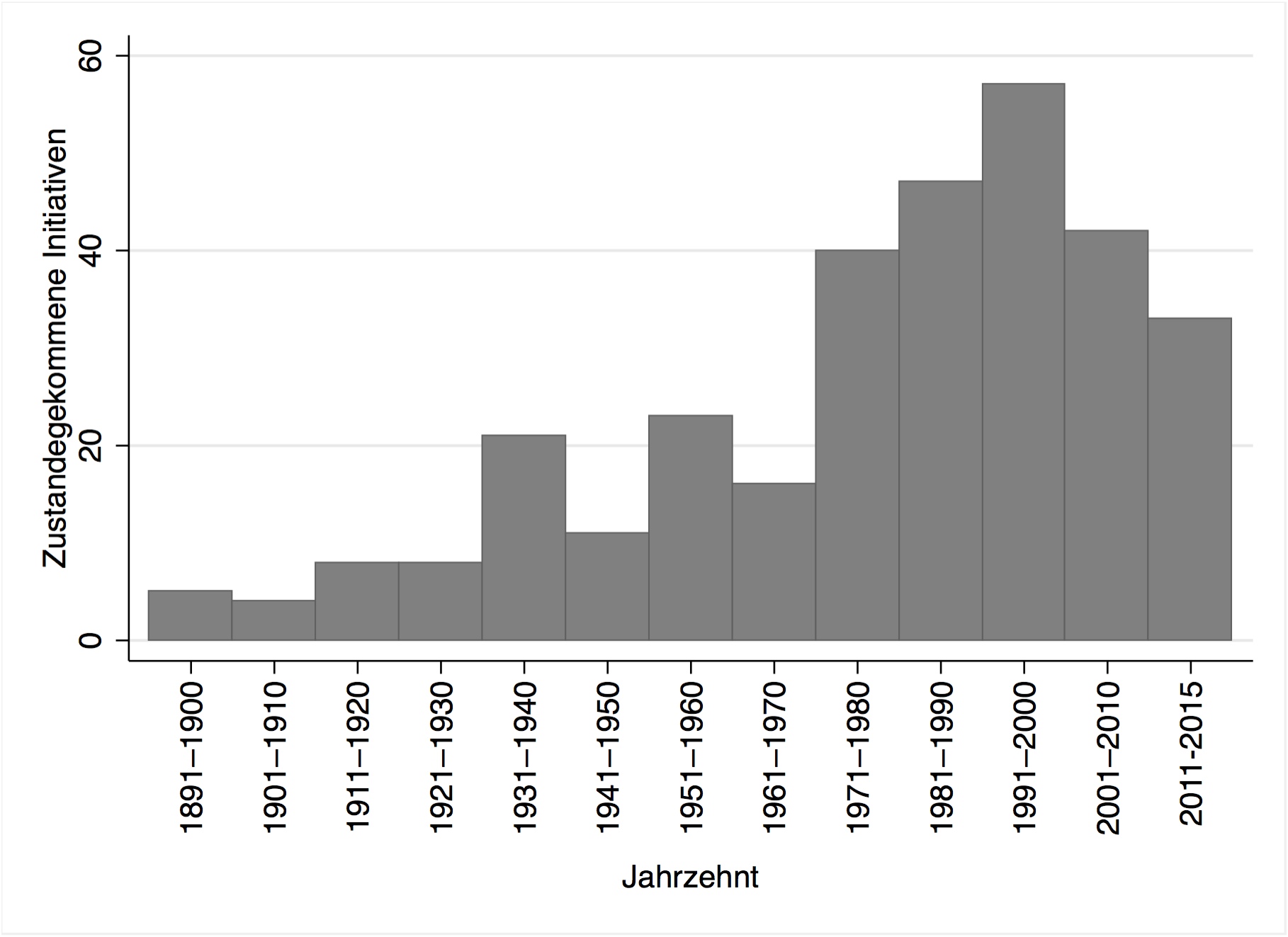Urs Birchler
Kürzlich hat der Leiter des Finanzstabilität bei der SNB, Bertrand Rime, in der NZZ eine glasklaren Standortbestimmung zum Too-Big-To-Fail-Problem in der Schweiz vorgenommen. Noch einiges bleibe zu tun, auch bei der Eigenmittelausstattung der Banken. Obwohl die Vorschläge moderat schienen, konnte der Präsident der WAK-NR, Ruedi Noser, nicht umhin, ebenfalls in der NZZ, zu warnen.
Die Stellungnahme ist bemerkenswert. Mit der einen Gehirnhälfte denkt Noser liberal: Der Staat soll nicht für private Risiken haften. „Die Too-big-to-fail-Regulierung bezweckt, dass eine Bank bei individuellen Fehlern auf Kosten der Geldgeber abgewickelt werden kann und nicht vom Steuerzahler gerettet werden muss. Das unterstütze ich als Liberaler zu 100%.“ In der anderen Gehirnhälfte hat er jedoch Angst vor den logischen Folgen des liberalen Denkens, d.h. vor der Notwendigkeit von Massnahmen, welche die implizite Staatsgarantie zurückdämmen. Keines seiner Argumente sticht aber:
- Eigenmittel verteuern Kredite. Das ist auch nach der 1001-sten Wiederholung noch nicht wahr. (Hansruedi Schöchli von der NZZ hat’s begriffen, siehe NZZ von heute, S. 27 und v.a. 36.)
- Regulierung führt zu Bürokratie. Das habe ich selber oft angeprangert; aber auch TBTF ist eine (versteckte) Regulierung. Und kaum etwas würde mehr Bürokratie produzieren als Nosers (rechtsstaatlich wohl kaum haltbarer) Vorschlag: „weitaus sinnvoller wäre es aber, wenn die Vorschriften zur Eigenkapitalunterlegung für jede Bank auf Grundlage ihrer Strategie und ihrer geschäftlichen Ausrichtung vom Regulator individuell festgelegt würde.“
- Eine global einheitliche Regulierung zwingt letztlich allen Banken weltweit dasselbe Geschäftsmodell auf. Gegenfrage: Zwingen die international geltenden Vorschriften zur Sicherheit im Flugverkehr allen Fluggesellschaften dasselbe Geschäftsmodell auf?
- Selbstverständlich gehen [die Banken] … Verlustrisiken ein, welche in Extremsituationen dazu führen können, dass die Bilanz einer Bank saniert werden muss. Im Extremfall braucht es dazu vielleicht sogar staatliche Mittel. Wollten wir nicht gerade das abschaffen oder eindämmen?
- Die Restrukturierungen der staatlich kontrollierten Axpo, BKW und Alpiq werden dem Steuerzahler weit höhere Kosten verursachen als die Rettung der UBS. Das klingt aufrichtig, scheint mir aber eher ein schwacher Trost. Zudem darf man die Kosten der UBS-Rettung nicht im nachhinein messen, sondern im Zeitpunkt der Rettung, wie Monika Bütler hier schon dargelegt hat.
Kurz: Was uns der Präsident der auf diesem Gebiet zuständigen Nationalratskommission auftischt, ist weder konsistent noch liberal.