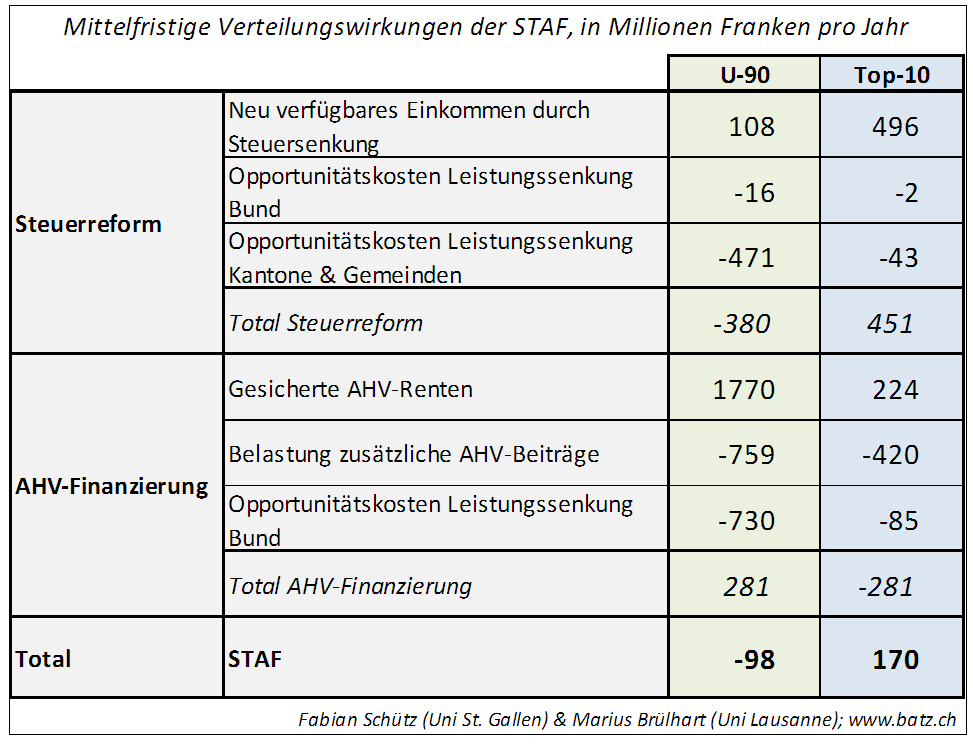Marius Brülhart
Die Coronakrise dürfte den Schweizer Schuldenabbau der letzten Jahre weitgehend zunichtemachen. 40 Milliarden hatte der Bund seit 2005 abgestottert, und die Bruttoschulden auf 90 Milliarden Franken gedrückt.
Wie die Pandemie beim Bund in der Endabrechnung zu Buche schlagen wird, ist noch offen. Die zusätzlichen Aufwendungen dürften infolge der getätigten und der bewilligten Ausgaben für 2020 und 2021 irgendwo zwischen 25 und 35 Milliarden Franken zu liegen kommen. Gemäss der Prognosen der Eidgenössischen Finanzverwaltung werden die Bundesschulden Ende 2021 um 25 Milliarden höher ausfallen als unmittelbar vor der Krise.
Das klingt nach einem herben Rückschlag. Ist es aber nicht, aus zwei Gründen.
Erstens haben wir heute eine grössere nominale Wirtschaftsleistung als noch zu Jahrhundertbeginn. Die Bundesverschuldung als Anteil am Bruttoinlandprodukt wird daher nach Corona immer noch wesentlich tiefer liegen als beim Höhepunkt von 2005. Damals entsprachen die Bundesschulden 25% des Bruttoinlandproduktes. 2019 waren es noch 12%. Nach Corona dürfte dieser Anteil auf 16% ansteigen.
Der zweite Anlass zu Gelassenheit sind die tiefen Zinsen. Schulden kosten den Staat im Moment fast nichts. Während der Schuldendienst im Jahr 2005 immerhin noch etwa 7% der Bundesausgaben wegfrass – vergleichbar mit den gesamten Ausgaben für die Landwirtschaft –, brauchte der Bund im Jahr 2019 für diesen Zweck noch etwa 1% seiner Ausgaben, Tendenz weiterhin sinkend.
Aus finanzpolitischer Sicht gibt es daher keinen unmittelbaren Anlass zu Sorge wegen der Corona-Schulden.
Und dennoch könnte es sich als ein Fehler erweisen, die höheren Schulden tatenlos hinzunehmen. Wie sich in der aktuellen Krise zeigt, ist eine tiefe Staatsverschuldung die beste Versicherung gegen privatrechtlich nicht versicherbare Katastrophen. Zudem wissen wir nicht, wie lange die Zinsen noch um den Nullpunkt herumdümpeln werden.
Vor allem jedoch hat sich die Schweiz mit der Schuldenbremse selber dazu verpflichtet, ausserordentlichen Schuldenanstiege wieder zurückzuzahlen. Gemäss gültigem Gesetz hat dies gar binnen sechs Jahren zu geschehen. Das würde einschneidende Sparprogramme und/oder Steuererhöhungen bedingen.
Aber die Schuldenbremse ist flexibel ausgestaltet. Eine einfache Parlamentsmehrheit kann die sechsjährige Rückzahlungsfrist verlängern, und diese Mehrheit wird sich ohne Zweifel finden lassen.
Wenn man die Frist ausreichend verlängert, werden die neuen Schulden quasi von selbst wegschmelzen. Der Bund gibt in normalen Zeiten pro Jahr durchschnittlich rund eine Milliarde weniger aus als er einnimmt, da regelmässig «Budgetreste» übrigbleiben – ein völlig normales Phänomen und Ausdruck eines sorgfältigen Umgangs mit Steuergeldern. Somit würde es ohne neuerliche Krisen zwischen 25 und 35 Jahren dauern, bis die Corona-Schulden abbezahlt wären.
Viele Politiker hätten das Problem aber lieber schon früher erledigt.
Das ist durchaus machbar. Der Schlüssel liegt beim Ausgleichskonto, auf welchem die ordentlichen Überschüsse der vergangenen Jahre verbucht sind. Der Saldo dieses Kontos liegt derzeit bei 29 Milliarden. Theoretisch könnte man voraussichtlich die gesamten Corona-Schulden mit diesem Saldo verrechnen und einfach stehen lassen. Damit würde sich der nominale Schuldenstand der Schweiz dauerhaft erhöhen, aber relativ zum BIP wären die Schulden immer noch wesentlich geringer als vor 20 Jahren. Dem Verfassungsauftrag der Schuldenbremse wäre somit eigentlich entsprochen.
Allerdings ist kaum damit zu rechnen, dass sich eine Mehrheit für ein Belassen der Corona-Schulden aussprechen wird. Nichts sollte den Bund jedoch daran hindern, beispielsweise die Hälfte der Corona-Schulden auf das Ausgleichskonto zu verbuchen, und den verbleibenden Teil mit den üblichen Kreditresten zurückzuzahlen. Bei einer solchen Halbe-Halbe-Lösung wären die Corona-Folgen in den Bundesfinanzen budgettechnisch in voraussichtlich 11 bis 16 Jahren gelöst.
Konkret würde dies bedeuten, dass der Bund nach Rückzahlung der halben Corona-Schulden wieder die gleiche Freiheit zurückgewinnen würde, die er seit Einführung der Schuldenbremse geniesst: Er könnte die jährlich wiederkehrenden Budgetreste wie bisher für einen weiteren Schuldenabbau einsetzen, oder er könnte sie mittels einer Anpassung der Schuldenbremse für Steuersenkungen oder Ausgabenerhöhungen verwenden.
Dieser Ansatz gleicht dem jüngsten Vorschlag der Finanzkommission des Nationalrats, gemäss welchem nach einer fixen Anzahl Jahren («mindestens 15») die noch verbleibenden Corona-Schulden auf das Ausgleichskonto übertragen und somit stehengelassen würden. Es stellt sich also die Frage, was man besser heute schon festsetzt: Die Anzahl Jahre während derer strukturelle Budgetüberschüsse für Corona-Schuldenrückzahlung reserviert sind, oder den Anteil der Corona-Schulden, der zurückzuzahlen ist? Wenn man bei ersterem Ansatz die Dauer so bestimmt, dass schliesslich der gleiche Anteil der Corona-Schulden aufs Ausgleichskonto übertragen wird wie man bei letzterem Ansatz festlegt, dann sind die beiden Lösungen ungefähr gleichwertig.
Auch eine Mischform ist vorstellbar: Ein Teil der Corona-Schulden wird sofort mit dem Ausgleichskonto verrechnet, der Rest ist im Prinzip über eine fixe Anzahl Jahre mittels Kreditresten zurückzuzahlen, aber allfällig verbleibende Corona-Schulden am Ende dieser Periode würden ebenfalls auf das Ausgleichskonto übertragen.
Die wirklich entscheidende Frage lautet wie immer, wo der marginale Bundessteuerfranken am besten aufgehoben ist: bei der Schuldenrückzahlung, bei zusätzlichen Ausgaben, oder gar nicht erst im Bundeshaushalt sondern im Portemonnaie der Steuerzahler? Vor Corona sprach viel für eine Steuersenkung statt für weiteren Schuldenabbau. Die Corona-Krise hat nun den Wert einer tiefen Schuldenlast neu aufgezeigt. Schuldenrückzahlung geht jedoch immer auf Kosten von gegenwärtigen Staatsleistungen oder von Steuersenkungen. Eine «Moitié-Moitié»-Lösung würde diesen gegenläufigen Ansprüchen in gut helvetischer Manier gerecht.