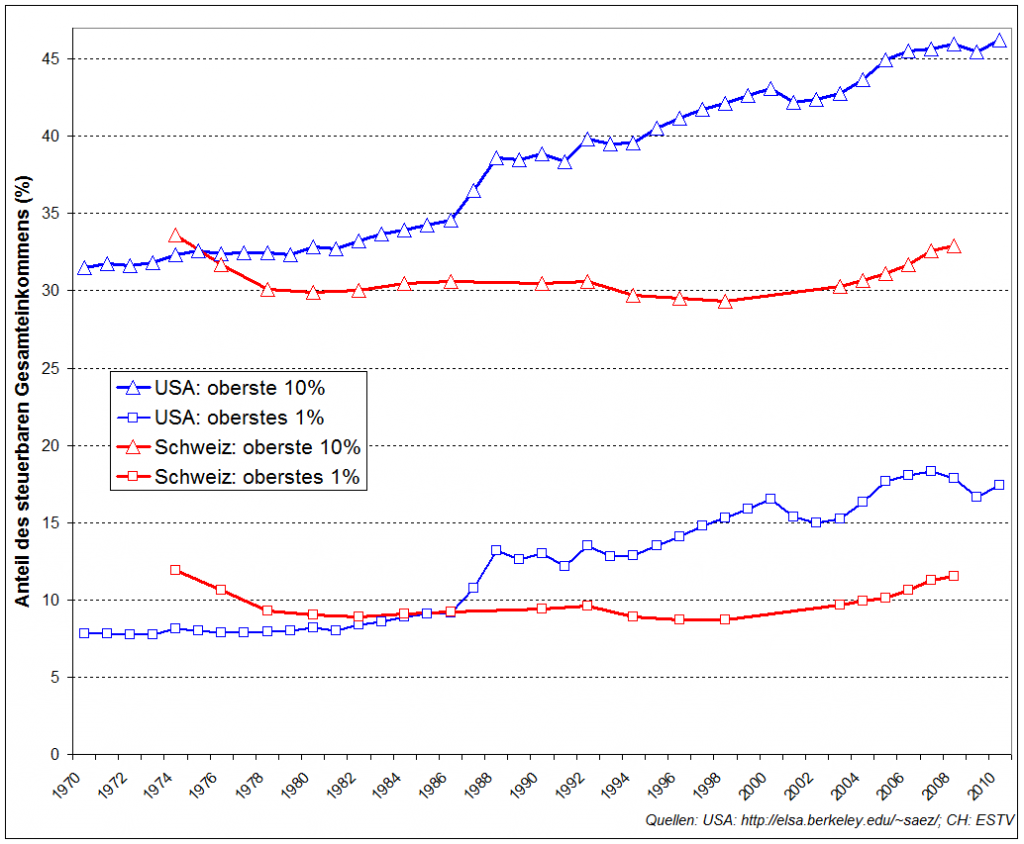Heute habe ich per email die Einladung erhalten, an einer Umfrage unter GA Abonnenten teilzunehmen. Die teilweise absurden Fragen erinnerten mich an eine andere (telefonische) SBB Befragung, die ich vor ein paar Jahren aufzeichnete.
„.. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass 5% der Anrufe zu Ausbildungszwecken aufgenommen werden…“. Dann Frage nach den Personalien usw.
„Mit welchem Fahrausweis reisen Sie meistens?“
„mit einem Generalabonnement der SBB“
„Benutzen Sie auch andere Fahrkarten wie Einzel- und Mehrfachkarten?“
„neben einem GA? Natürlich nicht“
„Besitzen Sie ein Halbtagsabonnement“
„Natürlich nicht“
„Wir stellen Ihnen nun einige Fragen zu von Ihnen unternommenen Fahrten in den letzten 4 Wochen. … Haben Sie in dieser Zeit eine Geschäftsreise unternommen? Wenn ja, von wann bis wann und wohin?“
„Ja, vom 4. bis 6. November nach Tilburg, Niederlande“
(im Rahmen einer Folgefrage zum Arbeitsweg) „Dann haben Sie also letzte Woche von Dienstag bis Donnerstag nicht gearbeitet?“
etwas später:
„Haben Sie in den letzten 4 Wochen eine Ferienreise unternommen?“
„Ja, von Zürich nach Lugano, am 15. Oktober“
„Wie viele km sind das?“
„etwa 200, aber das sollten Sie als Befragerin im Auftrage der SBB doch selber wissen“
„aha, 225km, wann genau sind Sie in Zürich abgefahren?“
„Das weiss ich nicht mehr „
„Sie wissen also nicht mehr genau, wann Sie abgefahren sind?“
„Nein. … Haben Sie denn keinen Eintrag „weiss nicht“?
„Nein“
„Dann schreiben Sie doch einfach 1 Uhr“
„Nein das geht nicht, wir müssen dies eben genau wissen und darum macht es keinen Sinn, mit Ihnen das Interview weiterzuführen. Ich kann nicht irgend etwas einfach etwas einfüllen, sonst kriege ich Schwierigkeiten.“
„Und Sie kriegen keine Schwierigkeiten, wenn Sie das Interview wegen einer komplett unwichtigen unvollständigen Information nicht weiterführen?“
„Nein, es ist eben sehr wichtig, diese Daten genau zu erheben zu können und so brechen wir das Interview hier ab.“
In der verzweifelten Hoffnung, das Gespräch werde tatsächlich aufgenommen, habe ich der Dame dann noch versucht zu erklären, weshalb diese Umfrage wohl kaum geeignet ist, verlässliche Infos zu Benutzung von ÖV zu liefern.
Auf solchen Informationen basieren dann wohl Strategieentscheidungen der SBB.