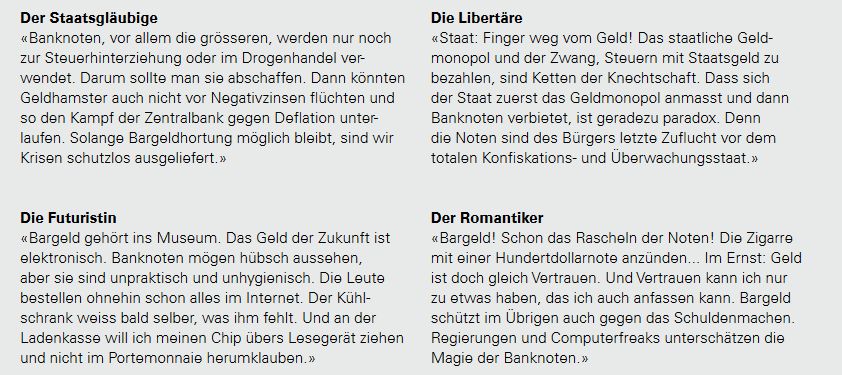Urs Birchler
„Die Welt soll die Schweiz dazu bewegen, dass sie die Ausgabe der 1000er-Note stoppt“, sagte gemäss Tagesanzeiger Larry Summers, der frühere US-Finanzminister und Wirtschaftsberater der Obama-Regierung.
Summers führt seit längerem eine Anti-Cash-Kampagne, zusammen mit Peter Sands, dem kürzlich entlassenen CEO von Standard Chartered. Summers argumentiert z.B. in der Washington Post, grosse Noten förderten die Kriminalität:
Our advocacy for the elimination of high denomination notes is based on a judgment that any losses in commercial convenience are dwarfed by the gains in combatting criminal activity.
Er stützt sich auf ein Working Paper von Sands (und Ko-Autoren). Ich habe mir die Mühe genommen, dieses anzusehen. Zahlen, welche die Rolle der grossen Noten in der Kriminalität belegen, findet man im 63-seitigen Bericht nicht wirklich. Hingegen folgt auf S. 39 eher verschämt das Eingeständnis:
[T]here is scant empirical evidence of the impact of eliminating high denomination notes.
Also: Bargeldverbote bringen nichts. Der Kreuzzug gegen die grossen Noten beruht weitgehend auf einer Illusion. Klar ziehen Bankräuber, Steuerbetrüger und korrupte Beamte grosse Noten den kleinen vor. Daraus folgt aber nicht der Umkehrschluss, ein Verbot der grossen Noten würde aus Kriminellen ehrliche Bürger machen. Sonst könnte man den Alkoholismus loswerden, indem man Flaschen über einem Deziliter verbietet.
Dass auch Spitzenökonomen erlahmen, wenn sie nur noch hochbezahlte Referate halten, anstatt nachzudenken, haben wir hier schon am Beispiel des Nobelpreisträgers Joseph Stiglitz festgestellt.
Bei Summers und Sands kommt aber etwas Unappetitlicheres dazu. Beide sind finanziell beteiligt an Unternehmen im Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Sie haben also ein wirtschaftliches Interesse an Bargeldverboten. Die Washington Post musste den Summers-Artikel deshalb ergänzen mit einem Transparenzhinweis: „Summers serves as an adviser or board member to a number of financial technology and payments companies.“
Es dürfte ihm trotzdem gelingen, internationale Organisationen gegen die Schweiz aufzubringen.
[Zum ersten Mal über Larry Summers Interessenkonflikt habe ich gelesen im Blog von Norbert Haering.]