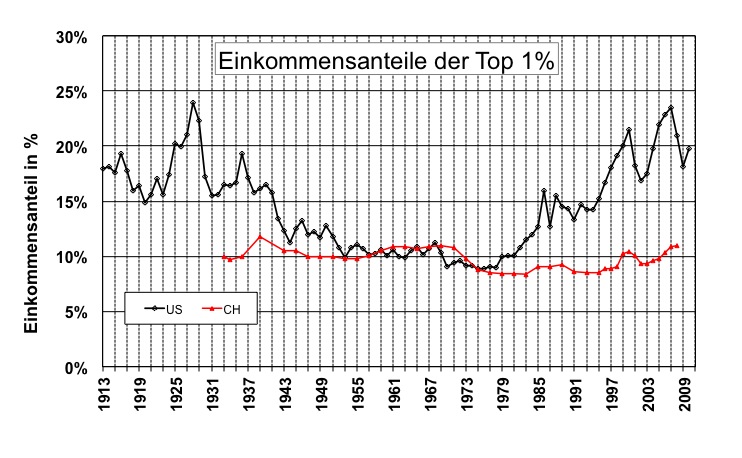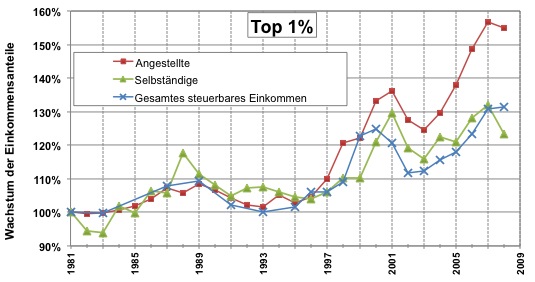Reto Föllmi
(Artikel aus Finanz und Wirtschaft)
Vielleicht ist es verfrüht, den Corona-Virus als Jahrhundertereignis zu bezeichnen. Das Jahrhundert ist noch jung und wir wissen nicht, was dieses Jahrhundert für uns alle noch bereithält. Mit Sicherheit ist es aber eine medizinische und wirtschaftliche Ausnahmesituation, die in jüngerer Zeit so nie vorgekommen ist. Die Wirtschaftspolitik muss bei einem so gewaltigen und plötzlichen Einbruch Vertrauen und Sicherheit schaffen. Arbeitnehmer und Selbständige brauchen dringend ihre Löhne und die Firmen benötigen weitere Liquidität, um weitere Rechnungen zu bezahlen.
Mit der grosszügig ausgestatteten Kurzarbeitsregelung werden die Löhne der betroffenen Branchen gesichert. Der Ausgleich ist aber nicht ganz 100%, so dass flexible Lösungen der Firmen in Arbeitszeit- oder Geschäftsmodellen wie Take-Aways belohnt werden. Dies schafft Sicherheit und ist auch aus Verteilungssicht sinnvoll, denn Arbeitnehmer aber auch Selbständige können sich gegen dieses Risiko nicht versichern.
Üblicherweise ist es Selbständigen verwehrt, auf die Kurzarbeit der ALV zuzugreifen, weil die Annahme von Aufträgen von ihnen selber abhängt. Der Einbruch aufgrund der Corona-Welle ist aber offensichtlich und in seiner Art einzigartig, was diese Hilfe für die Selbständigen eine gute und pragmatische Lösung macht. Allerdings sind auch selbständige Grafiker, Beraterinnen und Schreiner betroffen, deren Geschäftsaktivität nicht direkt behördlich geschlossen wurde. Es ist darum sinnvoll, dass der Bundesrat heute eine Ausweitung der Kurzarbeit auf diese Gruppen anbietet. Auch hier könnte die Differenz der Umsätze vor und während der Krise als Basis für die Entschädigung genommen werden.
Wie sieht es aber mit den übrigen Kosten und den Gewinnen, also der Entschädigung für das eingesetzte Kapital aus? Logischerweise muss hier die Liquidität für die Zahlung des Materials, der Mieten etc. sichergestellt sein, wie das mit den durch staatliche Bürgschaften gesicherten Covid19-Krediten der Banken geschehen ist. Die Kredite sind nach maximal 7 Jahren zurückzuführen, was für einen Geschäftskredit eine grosszügige Zeit ist und nicht zu exzessiver Schuldenlast führen muss. Die grosse Inanspruchnahme zeigt auch, dass dieses Programm auf eine grosse Nachfrage stösst.
In einer weiteren Auslegung des Versicherungsprinzips forderte mehrere Stimmen, dass der Gewinnentgang direkt über den Staat (teilweise) abgegolten werden sollte. Diese Forderungen lassen aber einen wichtigen Punkt ausser Betracht: das Kapital kann im Gegensatz zur Arbeit das Risiko weit besser tragen und bekommt für eben dieses Geschäftsrisiko ja in guten Zeiten eine Risikoprämie. Auch bei der Finanzkrise waren einzelne Branchen mehr betroffen und mussten die Verluste entsprechend selber berappen. Eine grossflächige Entschädigung oder nur teilweise Rückzahlung der Darlehen, um entgangene Gewinne zu kompensieren, wäre sehr teuer und würde auch hohe Mitnahmeeffekte von Unternehmern generieren, die auch noch davon profitieren wollen. In einer längeren Krise und wie von Lausanner Ökonomen angeregt wäre ein neues Programm denkbar, das nach dem Vorbild der australischen Studiendarlehen funktioniert, diese sehen im Erfolgsfalle eine raschere Rückzahlung vor. Prüfenswert ist auch eine Form der Brady-Bonds mit Abschlag nicht mehr für Staaten sondern für Firmen.
Auch wenn die Corona-Krise ist vielerlei Hinsicht einzigartig ist, stellt so eine Kompensation einen Präzedenzfall dar, der nur schwer aus der Welt zu schaffen wäre. Ähnliche Forderungen wären bei der nächsten Krise vorprogrammiert. Auch in der Finanzkrise waren einzelne Branchen stärker betroffen als andere. Wenn das Eigenkapital nun wiederholt einen von der Allgemeinheit zu berappenden Versicherungsschutz geniessen würde, womit liesse sich dann in Zukunft eine Risikoprämie für das Eigenkapital noch rechtfertigen? Dem schon in der Finanzkrise geäusserten Vorwurf, die Gewinne würden privat vereinnahmt die Verluste dann aber sozialisiert, käme erst recht eine gewisse Berechtigung zu.
Die Coronakrise ist eine Kombination von Nachfrage- und Angebotsschock. Die Nachfrage ist vielerorts eingebrochen und wir geben nichts mehr für Restaurants oder Anlässe aus. Aber das Angebot ist eben auch eingeschränkt. Weil viele wegen online Meeting, Kinderbetreuung etc. nicht gleich produktiv sind und Angestellte in Branchen wie Tourismus, Events gar nicht arbeiten können, liegt das ganze Produktionspotential tiefer. In «gewöhnlichen» Rezession wirksame Ankurbelungen der Wirtschaft sind darum im Moment wirkungslos. Eine Stimulierung der Wirtschaft während des partiellen Lockdowns ist gar nicht möglich und zudem aus Ansteckungsgründen gar nicht erwünscht.
Wegen des Produktionsabfalls können wir gar nicht den ganzen Kaufkraftverlust ersetzen. Würde im Extremfall der Staat 100% aller Ausfälle übernehmen und die Kaufkraft nominell voll erhalten, könnte nach Ende des Lockdowns eine gleiche oder wegen Nachholbedürfnissen noch gesteigerte Nachfrage auf ein verringertes Angebot treffen, das auch durch Überstunden nicht beliebig ausgeweitet werden kann. Das Resultat wäre zum ersten Mal seit Jahren Inflation nicht nur auf den Aktien- und Immobilienmärkten sondern auch für Güter und Dienstleistungen. Detailhändler verzichten bereits jetzt auf Aktionen und im Medizinalbereich sind Preissteigerungen schon eingetreten. Was die Zentralbanken in den vergangenen Jahren vergeblich zu erreichen suchten, wäre über einen nie vorausdenkbaren Weg eingetreten.