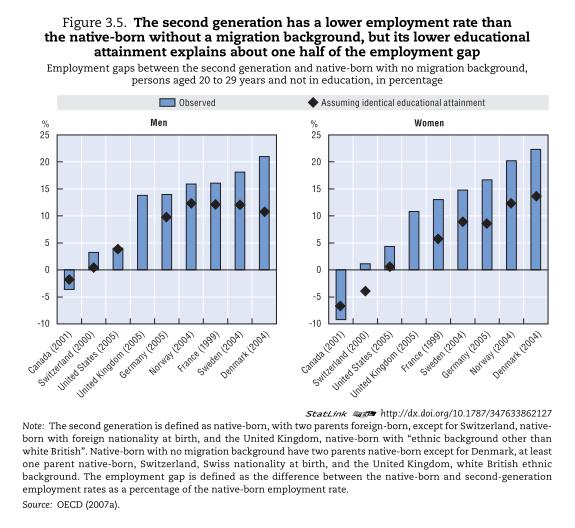George Sheldon plädiert in der NZZ vom 9. September für eine risikogerechte Prämie in der Arbeitslosenversicherung. Sein Argument ist, dass nicht nach Risiko abgestufte Prämien die Entscheidungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer verzerrten. In riskanteren Berufen (wie beispielsweise im Gastgewerbe) würden daher Leute zu schnell entlassen, da die Kosten der Allgemeinheit aufgebürdet werden könnten. So weit so gut. Die vorgeschlagene Lösung – risikogerechte Prämien, nach Berufsgruppen abgestuft – hat allerdings ihre Tücken.
So gibt es erstens beträchtliche Unterschiede in den Arbeitslosenquoten innerhalb einer Branche. Die Umverteilung passiert dann von den “Guten” innerhalb einer Branche zu den “Schlechten”. Wenn schon risikogerechte Prämien müsste, wie dies in der Risikoversicherung des BVG bereits passiert, nach Betrieb, respektive Kasse, unterschieden werden.
Zweitens sind die höheren Risiken vor allem bei den wenig Verdienenden zu finden. Eine Abstufung der Prämien nach Berufsgruppe scheint mit aus sozialen, und politischen Gründen wenig opportun. Es gibt auch Sozialversicherungen, bei denen die Umverteilung zu den besser Verdienenden geht, wie ich in meiner NZZ Kolumne vom 24. Januar geschrieben habe. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass der Vorschlag eine politische Mehrheit findet. “Weniger Prämien für Beamte und Banker” wäre doch eine wunderbare Schlagzeile. Beim Volk dürfte das Begehren wenig Begeisterung auslösen (bei mir auch nicht).
Das bringt mich zum dritten und eigentlich wichtigsten Punkt: Die Frage ist, was eine Sozialversicherung überhaupt versichern soll. Ist es lediglich die Absicherung der Existenz gegen die finanziellen Folgen von Krankheit, Erwerbslosigkeit und Alter? Oder gehörte nicht noch dazu, dass eine Sozialversicherung auch gegen das Risiko, ein schlechtes Risiko zu sein, versichern soll? Wer noch nicht weiss, ob er/sie zu den schlechten oder guten Risiken gehört, würde sich – unter dem Schleier der Unwissenheit – für eine Versicherung ohne Abstufung nach Risiko entscheiden.