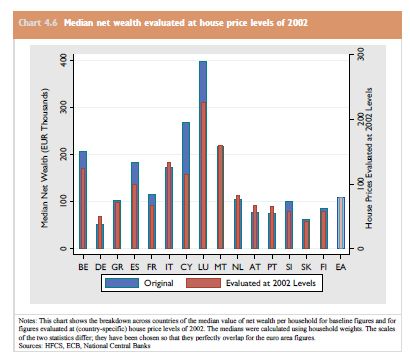Monika Bütler
(meine 3.-letzte NZZ am Sonntag Kolumne: publiziert am 19. Mai 2013 unter dem Titel „Bildung bringt nicht mehr Lohngleichheit“)
Ich bin eidgenössische Durchschnitts-Verdienerin. Zugegeben: nicht heute, aber über die ganze Berufslaufbahn gerechnet. Ich habe in den letzten 30 Jahren ziemlich genau den schweizerischen Durchschnittlohn verdient. Dies ohne statistische Tricks: Meine früheren Löhne sind sauber hochgerechnet auf heutige Löhne. Trotzdem lag mein Einkommen während eines Drittels meines Arbeitslebens unter oder nahe der Armutsgrenze. Es ging mir natürlich auch in jenen „armen“ Zeiten gut – in jungen Jahren dank dem Zustupf der Eltern; später half der Griff in den Sparstrumpf über die kargen Zeiten.
Bestünde die Schweiz nur aus verschiedenen Jahrgängen meiner selbst, betrüge der Gini-Koeffizient ungefähr 0,46. Der Gini ist ein Mass für die Ungleichheit zwischen null (alle verdienen gleich viel) und eins (einer kriegt alles). Mein „Lebens-Gini“ entspricht damit ungefähr dem der Einkommensverteilung in den USA; die Schweiz ist mit gut 0,3 deutlich ausgeglichener. Am Rande bemerkt: Würde ich heute als Chefin meine früheren Kopien anstellen, käme ich sogar in die Nähe von 1:12. Mehr als heute dürfte ich dann aber nicht mehr verdienen.
Glücklicherweise besteht die Schweiz nicht nur aus Jahrgangs-Klonen meiner selbst. Das Gedankenexperiment illustriert aber klar: Der punktuelle Blick auf die Einkommens- und Vermögensverteilung wird der Wirklichkeit oft nicht gerecht. Mein Einkommensprofil ist zwar nicht repräsentativ, aber auch nicht so aussergewöhnlich. Denn zu jedem Zeitpunkt leben in einem Land Menschen in den unterschiedlichsten Phasen im Lebenszyklus. Auch eine reiche Frau wird zwangsläufig manchmal in ihrer „Armutsphase“ registriert – sei es nur wegen eines Zweitstudiums oder einer umgebauten Küche.
Politische Vorstösse zur Einkommensverteilung haben Hochkonjunktur. Die Einkommensschere hat sich geöffnet, wenn auch moderat und nicht stärker als in den 1970er Jahren. Zudem ist für viele die fehlende Bodenhaftung einiger Spitzenverdiener das grössere Ärgernis als die Lohnschere an sich. Gerade deswegen ist es wichtig, die Rolle des Lebenszyklus in der Einkommensverteilung nicht zu vergessen. Die gemessene Ungleichheit kann nämlich ohne grundlegende Änderung im Lohngefüge zunehmen. Dies über drei Kanäle: Ausbildung, Berufstätigkeit der Frauen, Alterung der Gesellschaft.
Frauen: Früher zogen sich Mütter aus dem Arbeitsleben zurück, heute bleiben viele berufstätig – vor allem solche mit tiefen Löhnen (weil sie arbeiten müssen und die Kinderbetreuung subventioniert erhalten) und solche mit hohen Löhnen. Mütter aus dem Mittelstand hingegen werden mit einem absurden Subventions- und Steuerregime aus dem Arbeitsmarkt geekelt. Dazu kommt, dass sich das Bildungsniveau der Ehepartner immer mehr annähert; gleich und gleich gesellt sich heute lieber als früher. Beides zusammen führt im Quervergleich zu mehr gemessener Ungleichheit.
Demographie: Abschlussklassen einer Ausbildung ähneln sich alle; mit jedem Klassentreffen aber werden die Unterschiede innerhalb der Klasse grösser. Je mehr Menschen im fortgeschrittenen Alter es in einem Land gibt, desto grösser fallen auch die Einkommensunterschiede aus, ohne dass sich – ausser der Demographie – etwas ändert.
Ausbildung: Eine berufliche Weiterbildung oder eine akademische Laufbahn vergrössert die Einkommensunterschiede über den Lebenszyklus automatisch. Wie in meinem Fall: In jungen Jahren sind die Einkommen wegen Studium und Praktika gering, später schlagen sich die Ausbildungsinvestitionen (hoffentlich) in höheren Löhnen nieder.
Ironie der Politik: Gerade die Investitionen in die Bildung eint rechte und linke Kreise im Bestreben nach mehr Wohlstand. Mehr Gleichheit sollten sie dabei nicht erwarten: Bildungsinvestitionen mögen die gefühlte Ungleichheit verringern. Die gemessenen Einkommensunterschiede in der Volkswirtschaft verkleinern sie dagegen kaum.